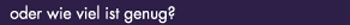Exegetische Anmerkungen und Anregungen zur Auslegung
1. Petr 3, 8-15
Die Christen, die im 1. Petrusbrief angesprochen werden, sind bedrängt, leiden unter sozialer
Diskriminierung, die allein schon der Tatsache geschuldet ist, dass sie der christlichen
Gemeinde angehören. Sie sind als Minderheit mit ihrem andersartigen Lebensstil und ihrer
religiösen Praxis Fremde in ihrer Umwelt. Der 1. Petrusbrief ist die Schrift im NT, die
am stärksten das Zeugnis des Wortes mit dem Zeugnis des christlichen Handelns in der
Gesellschaft verbindet. Die Christen sind in ihrer Präsenz erkennbar durch die Art, wie sie
untereinander Gemeinschaft halten und das Zusammenleben mit den Mitmenschen außerhalb der
Gemeinde alternativ gestalten. Sie machen ernst mit dem Gottesdienst im Alltag der Welt (vgl.
Röm 12, 1 f). Er erhält seine Qualität und Signalwirkung nach außen durch gelebte
Geschwisterlichkeit, die sich durch gegenseitigen Respekt und Solidarität, geleitet durch
Mitgefühl, auszeichnet. Kennzeichen soll, bei aller Verschiedenheit der Gemeindeglieder, die
Bereitschaft sein, jederzeit gegenüber allen Rechenschaft zu geben von der im Glauben
begründeten Hoffnung (Einheitsübersetzung: "Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu
stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt") Nicht Rückzug aus der Öffentlichkeit,
sondern aktive, keineswegs anbiedernde oder selbstgefällige Demonstration ihrer vom Willen
Gottes geprägten Lebensweise, macht ihre Mission aus. Sie geben Zeugnis nach dem Motto: "Wie
du lebst, sagt mehr, als was du sagst." Allerorts gilt es Gutes zu reden und zu tun, um
Menschen, auch "ohne Worte zu gewinnen" (3,16). Es sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern
die aus der frohen Botschaft erwachsenden Zumutungen: Böses nicht mit Bösem zu vergelten; den
Gegnern gegenüber auf die Durchsetzung des eigenen Rechts zu verzichten; dem Hass mit Liebe zu
begegnen; durch das Wort des Segnens Raum zu schaffen für heilende Beziehungen.
Der Text fordert dazu auf, sich der Frage zu stellen, worauf sich Hoffnung gründet. Hoffnungen
werden immer wieder zerschlagen, weil sie trügen, blind sind und sich als Illusionen erweisen.
Was ist das biblische "Salz der Hoffnung"? Nicht Materielles ist die "Mutter der Hoffnung"
(E. Bloch). Auch nicht die Menge menschlicher Errungenschaften. Für Christen ist Hoffnung
nicht zu trennen von Gott (Eph 2, 12). Vielmehr "haben wir unsere Hoffnung auf den
lebendigen Gott gesetzt" (1 Tim 4, 10). Es ist kein gesichtsloser Gott, sondern der
mit dem menschlichen Gesicht, wie er in dem Antlitz des Jesu von Nazareth sichtbar geworden und
uns nahe gekommen ist. Sein Lebensweg, der mit Leiden und Kreuzestod endete, bedeutet für
diejenigen, die sich auf seine Spuren begeben, dass der Weg weder harmlos noch triumphalistisch
ist. Das erfuhren die Christen, an die sich der 1. Petrusbrief richtet. Das Festhalten an
der Hoffnung lassen sie sich etwas kosten.
Rechenschaft zu geben impliziert, dass auf Anfragen, Rückfragen, auf das Hinterfragen und
in Frage stellen von anderer Seite geantwortet wird. Das kann die Form von Rechtfertigen und
Entschuldigen annehmen (was mit dem griechischen Wort apologia auch gemeint sein kann). In der
petrinischen Gemeinde ist Rechenschaft geben als Verantwortung gegenüber der Gabe und dem
Anspruch des Evangeliums verstanden und gelebt worden. Ausgesprochen oder unausgesprochen sind
christliche Gemeinden und ihre Mitglieder in unserem Land aufgefordert, die mit dem Evangelium
proklamierten Zusagen und Ansprüche in der Öffentlichkeit glaubwürdig zu vertreten. Sie sind,
trotzdem sie zunehmend kritischer beurteilt werden, in einer vergleichsweise komfortablen Lage
in Deutschland. Ganz anders ist die Situation z.B. von (koptischen) Christen in Ägypten, in
Pakistan, Malaysia, Nordkorea, denen eine freie Religionsausübung oft nur unter erschwerten
Bedingungen und mit Benachteiligungen möglich ist.
Rechenschaft der Hoffnung ist unabdingbar für die Trias Gerechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung der Schöpfung nicht nur angesagt, sondern muss sich im Reden und Handeln der Kirchen
und ihrer Gemeinden glaubwürdig in der Öffentlichkeit erweisen. Das diesbezügliche Engagement
duldet weder Aufschub, noch kann es dafür ein Alibi geben. Die Mahnung in unserem Text, dass
dies jederzeit und gegenüber allen, also ausnahmslos, zu geschehen hat, ist nicht zu
übersehen. Eine Fülle von konkreten Bezügen würde hier zu nennen sein. Andeutungsweise seien
aufgeführt:
Die von den Kirchen deutlich zu äußernde Infragestellung der immensen Mittel, die für die
Rüstung und das Militär ausgegeben werden, demgegenüber die Mittel, die für die Förderung und
Gestaltung eines gerechten Friedens verschwindend gering sind. In der "Botschaft der
internationalen ökumenischen Friedenskonvokation" (Mai 2011 in Jamaika) heißt es dazu: "Es ist
ein Skandal, dass gewaltige Summen für Miltärhaushalte, die Lieferung von Waffen an Verbündete
und den Waffenhandel ausgegeben werden, während dieses Geld dringend für die Beseitigung von
Armut in aller Welt und die Finanzierung einer ökologisch und sozial verantwortlichen
Neuausrichtung der Weltwirtschaft gebraucht würde."
Rechenschaft der Hoffnung ist heute unabweisbar auf den Klimawandel zu beziehen, für den
wir in den Industriestaaten in erster Linie verantwortlich gemacht werden müssen. Im
Römerbrief (Kap 8) schreibt Paulus hoffnungsvoll: "Auch die Schöpfung soll von der
Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn
wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt".
Die durch menschliches Verhalten misshandelte Erde schreit zum Himmel. Eingefordert ist von den
Christen ein eindeutiges Eintreten für Gerechtigkeit gegenüber den vom Klimawandel
benachteiligten Menschen und der geschundenen Natur. Was D. Bonhoeffer kurz vor seiner
Verhaftung zum Jahresende 1942/43 schrieb, gilt heute im Blick auf die ganze Schöpfung: "Die
letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie
eine kommende Generation weiterleben soll." Nachhaltige, hoffnungsvolle Schritte in die
richtige Richtung z.B. mit der Absage an die Verwendung von Atomkraft mit ihrem unabsehbaren
Gefahrenpotential und der eingeleiteten Energiewende sind hierzulande auf den Weg gebracht
worden.
2 Kor 8, 7.9.13-15
Die Hilfsaktion per Kollekte der heidenchristlichen Gemeinden speziell für die Jerusalemer
Urgemeinde ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der dortigen materiellen Not zu sehen. Es ist
auch Ausdruck des Dankes für die erfahrenen Segnungen, die in der Jerusalemer Gemeinde ihren
Ausgangspunkt haben. Zugleich sollte mit der Geldsammlung die Einheit der Kirche, in der Juden
und Heiden gleichberechtigt sind, demonstriert werden. In der Hingabe für die anderen soll die
in Korinth angesprochene Gemeinde dem Beispiel Christi folgen, der unter Verzicht auf
Privilegien jeglicher Art ein Leben in Armut auf sich genommen hat. Es ist eine bleibende
Verpflichtung in der Gemeinschaft der christlichen Kirchen, dass diejenigen, denen ein größeres
Maß an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht, den weniger Bemittelten unter die Arme greifen
und somit für einen Ausgleich sorgen. Doch ist es inzwischen in vielen Kirchen
selbstverständlich geworden, darüber hinaus den Menschengeschwistern, die unter Armut und
vielseitigem Mangel zu leiden haben, ohne Rücksicht auf deren Religionszugehörigkeit
solidarisch beizustehen. Die großen Hilfswerke von Brot für die Welt und Misereor sind zusammen
mit vielen anderen Werken mit ihren Initiativen, Programmen und Maßnahmen ausführende Organe
für den Dienst an den nahen und fernen Nächsten.
Weisheit 1, 13-16; 2, 23-24
Weisheit ist ein unverzichtbarer Bestandteil biblischer Literatur und Inhalte, also keineswegs
etwas Nebensächliches oder gar Überflüssiges. Denn Weisheit umfasst die ganze Lebensgestaltung,
sowohl die Einsicht in das Schöne und Gute, in das Geregelte und Gerechte, als auch die
Konsequenzen, die aus der Einsicht folgen müssen. Es geht also mitnichten um eine abstrakte
Weisheit. Sie ist gegründet in der Beziehung zu Gott. Die Ehrfurcht vor dem Leben ist
untrennbar mit der Ehrfurcht vor Gott verbunden. Der vorliegende Text ist ein starkes Plädoyer
für das Leben, und zwar ein Leben in Gerechtigkeit. Das Gegenbild zu denen, die sich an die
Gott gegebenen Gesetze halten, sind diejenigen, die angesichts der befristeten Lebenszeit diese
zu genießen und auszukosten suchen (2,6). Das geschieht bewusst und eindeutig zu Lasten der
Armen (Witwen, Alte, Gerechte / 2, 10 ff.) Hemmungslos und gewalttätig geht man gegen die
vor, die sich der Gerechtigkeit und dem Gemeinwohl verpflichtet wissen.
Beispiele dafür, dass die Lebensrechte und die Würde von Menschen sowie der Einsatz für
gerechtere Verhältnisse wegen der Profitgier weniger mit Füßen getreten werden, gibt es
zuhauf. Vielerorts müssen Arbeitnehmende Beschäftigungen nachgehen, die etwa durch Schadstoffe
bei der Produktion folgenschwer für ihre Gesundheit sind. (z. B. in Bereichen der
Textilindustrie und Landwirtschaft; die Betroffenen sind oft Kinder und Frauen). Ein
afrikanisches Sprichwort hat die Mühe und Last vieler Arbeitsvollzüge mit den Worten
ausgedrückt: "Wer das Ei isst, weiß nicht, wie schmerzhaft es für das Huhn war, das Ei zu
legen". Man könnte es auch auf tägliche Gebrauchsgüter anwenden, z.B.: Wer Tee oder Kaffee
trinkt, Schokolade oder Bananen isst oder sich kleidet, weiß nicht, wer zu welchen Bedingungen
es durch seine Arbeit für uns produziert hat. Für Gemeinden / Christen gilt es, darüber
nachzudenken, sich zu informieren, dazu sich zu verhalten und Stellung zu nehmen (z.B.
Eintreten für faire Produktions- und Vermarktungsweisen).
|